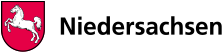Innovate me! – Was Ideen am meisten brauchen [Teil 1]
"Heureka!", sagte die Wissenschaftlerin und gebar eine Jahrhundertidee. So oder so ähnlich stellen wir uns meistens die Momente vor, in denen große Ideen und Erfindungen das Licht der Welt erblicken. Geschaffen von den besten und intelligentesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, einsam und alleine in absoluter Stille und Zurückgezogenheit. Jedoch: So ist es nur selten. Sehr viel mehr entwickeln sich Innovationen vollkommen anders. Teil 1 einer neuen mIT.gedacht-Kolumne.
Im aktuellen Essay soll es um die grundlegenden Rahmenbedingungen gehen, in denen Ideen und Innovationen gedeihen. Nicht um Prozesse, Genehmigungsvorbehalte, Business Cases und Return-of-invest-Berechnungen. Das sind auch wichtige Schritte zu neuen Produkten, aber am Anfang steht immer die Idee als solche. Und nur davon sowie von den allgemeingültigen Grundprinzipien werden die folgenden Gedanken handeln.[1]
Sehr oft erscheinen Ideen und Innovationen als Quantensprünge, als visionäre Meilensteine von superintelligenten Menschen. Das sind jedoch nur seltene Einzelfälle, die Wirklichkeit ist wesentlich profaner. Bereits in der Evolution zeigt sich vortrefflich, was damit gemeint ist. Die Natur selbst hat schon immer die eigene Entwicklung auf Basis dessen geleistet, was möglich ist, und zwar durch Kombination von bestehenden Elementen zu etwas Neuem. Die Natur konnte nie eine Evolutionsebene überspringen und etwas vollkommen Neues entwickeln. Gleiches gilt auch für uns Menschen: Schon immer wurden die allermeisten Erfindungen auf Basis bekannter Einzelteile geschaffen. Hierbei gilt, dass die Kombinationen erster Ordnung zwar endlich sind, aber jede Kombination von Kombinationen das Spektrum der nächstmöglichen Innovation deutlich erweitert.
Das nächste, große Ding wartet nebenan
Das ist schon die erste allgemeingültige Regel: Finde das Nächstmögliche. Ideen außerhalb des Nächstmöglichen sind oft zum Scheitern verurteilt, da sie zum aktuellen Zeitpunkt nicht realisierbar sind. Als Beispiele können alle frühen Ideen zum Fliegen oder für Rechenmaschinen oder auch für bestimmte Web-Dienste wie YouTube herangezogen werden. Mitunter vergingen zwischen Idee und Realisierung 100 Jahre und mehr, weil einfach die Zeit noch nicht gekommen war.
Menschen müssen durch passende Umgebungen unterstützt werden, das Nächstmögliche zu erkunden. Es sollten alle Arten von Zubehör vorrätig sein, physikalischer genauso wie konzeptioneller Art. Es ist nötig, die Inspiration für die Kombination des Bekannten zur Entdeckung des Nächstmöglichen zu fördern. Experimentieren muss gewollt sein und darf nicht bestraft werden.
Ein anschauliches Beispiel lässt sich auf Basis der Realität in einem Film wiederfinden: Während des Flugs der Apollo 13 musste ein Kohlendioxidfilter gebaut werden, wobei die Crew nur mit einigen Gegenständen an Bord arbeiten konnte. Das Bodenteam zeigte höchstmögliche Kreativität und erfand den nächstmöglichen Filter auf Basis des Bestehenden.
Synapsenjäger
Die Geburt von Ideen benötigt darüber hinaus eine fördernde Umgebung. Was ist wohl die großartigste Erfindung der Evolution? Ich meine, es ist das menschliche Gehirn. Es ist deshalb so fantastisch, weil es auf sehr wenig Raum eine Unmenge an Informationen verarbeiten kann. Es kann sich entwickeln, neu zusammensetzen und fortlaufend verändern. Die Anzahl der Nervenverbindungen, also das biologische Netzwerk, übersteigt alle Verbindungen des weltweiten Internets um ein vielfaches. Die Veränderbarkeit der Synapsen ist dabei eine wesentliche Voraussetzung für alle Möglichkeiten, die wir Menschen dadurch haben.
Die Physik kennt drei Aggregatzustände: gasförmig, flüssig und fest. Gas bedeutet eine bestimmte Art des Chaos und Durcheinanders, es wird so gut wie keine Berührung von Partikeln innerhalb des Gases geben. Feste Elemente sind dagegen starr, unbeweglich, und es gibt keinerlei Berührungspunkte mehr untereinander. Im flüssigen Aggregatzustand geht es deutlich dichter als im Gas zu, die Teile sind beweglich, es gibt deutlich mehr Berührungspunkte untereinander. Überträgt man diese Fakten auf die Evolution, zeigen sich erneut Parallelen. Menschen in den frühen Kleinstgruppen (Jäger und Sammler) waren gasförmig, da sie sich kaum einmal trafen. Erst mit Beginn der festen Ansiedlungen wurden sie quasi flüssig, da nunmehr erstmals Menschen in großen Mengen untereinander zusammenkamen, und das immer wieder mit der Möglichkeit eines Informations-Austauschs. Der Effekt war enorm: Es gab in vergleichsweise kurzer Zeit Innovationen in riesiger Menge im Vergleich zu den Jahrtausenden vor der Gründung erster Siedlungen und Städte.
Superlineares Wachstum
Die Anzahl der Kombinationen von Informationen und damit die Wahrscheinlichkeitshöhe von Entdeckungen aller Art hängen dabei von der Größe der Umgebungen ab. Wenn beispielsweise lediglich zwei Menschen dauerhaft zusammen leben und arbeiten, wird aus dieser Gruppe mutmaßlich keine Innovation entstehen. Ganz anders sieht es aus, wenn die Gruppe aus 20, 200 oder 20.000 Menschen besteht. Untersuchungen haben dabei das aus der Mathematik abgeleitete Bild der "superlinearen Urbanisierung" aufgezeigt. Demzufolge ist eine zehnmal größere Stadt nicht etwa auch zehnmal innovativer als die kleinere Vergleichsstadt, sondern gemäß der Studien 17-mal. Und eine 50-mal größere Stadt ist sogar 130-mal innovativer.
Übrigens ist mit dieser scheinbar größer werdenden "Intelligenz der Masse" nicht die heute bekannte "Schwarmintelligenz" gemeint. Vielmehr geht es um (höhere) Intelligenz einzelner in der Masse. Ein Netzwerk im Sinne eines Schwarms ist nicht per se klug, vielmehr wird der Einzelne durch Informationsaustausch klüger mittels der Verbindungen im Netzwerk.
Zurück zu unserer Arbeitswelt: Innovationen und Ideen entstehen nicht in Einzelbüros oder Laboren, vielmehr bei Begegnungen, oftmals auch vollkommen ungeplant und zwanglos, bestenfalls in möglichst heterogenen Umgebungen mit unterschiedlichen Menschen verschiedener Fachrichtungen. Es geht immer um die Erweiterung des eigenen Horizonts und Blickwinkels. Neue, selbst unbekannte Gedanken führen zu neuen Einsichten und am Ende eventuell zum entscheidenden „Heureka“-Moment, den man alleine nie gefunden hätte.
Im Netzwerk schwimmen
Ergo: Die physische Beschaffenheit der Arbeitsumgebung hat direkten Einfluss auf die Innovationsfähigkeit in einem Netzwerk. Das ist die zweite Voraussetzung für Innovationen: ein flüssiges Netzwerk. Ein festes Netzwerk (Einzelbüros mit verschlossenen Türen) wird keine Ideen hervorbringen. Große Gemeinschafträume mit vielen Begegnungsmöglichkeiten hingegen sind Garanten für viele Ideen. Nicht gemeint sind damit übrigens klassische Großraumbüros, die noch nie für Innovationen gut waren. Es muss die richtige Symbiose zwischen beiden Welten gefunden werden, ein guter Mix von Rückzugsmöglichkeiten und offenen Werkstätten im weitesten Sinne.
Wenn Sie Lust auf mehr bekommen haben, wenn Sie noch wissen, was eine Kassette und ein Bleistift miteinander zu tun haben und wenn Sie unbedingt wissen wollen, welches Utensil dem Autor in der Dusche oftmals fehlt, dann freuen Sie sich schon jetzt auf Teil 2 – sehr bald hier auf diesem Kanal.
[1] in Anlehnung an die Arbeiten des Amerikaners Steven Johnson